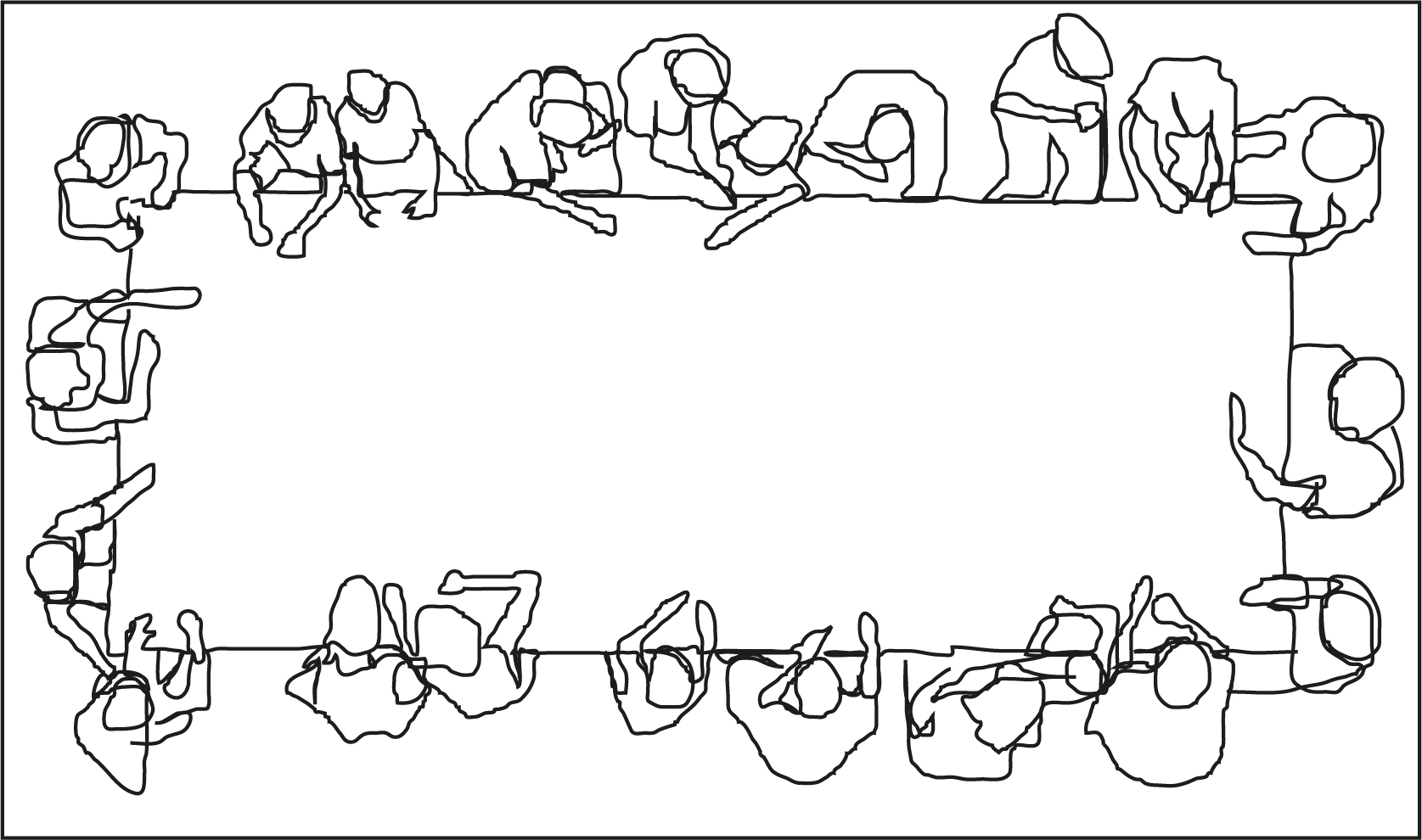„Willkommen in der Szene“, attestiert er mir, Hand zum Schütteln ausgestreckt, nachdem ich ihm von meinem neuen Job erzähle. Durch diesen Satz wird ein Raum eröffnet, der sich gleichzeitig vor mir verschließt. Ich frage mich, wie er darauf gekommen ist, mir ein „Willkommen“ entgegenzubringen. Da „die Szene“ sich doch durch ihre charakteristische Heterogenität auszeichnet und nicht wirklich abgeschlossen werden kann, wird der Inhalt der Aussage umso redundanter.
Der Zusammenhang, in dem du dich bewegst, gehört dir nicht, gehört mir nicht, gehört niemandem, genau darum kann er so transformativ sein. Es gibt Ausnahmen und Regeln, die gebrochen werden (müssen). Aus einer männlichen Arroganz heraus spricht er von einer Parallelwelt, die ihm gehört. Willkommen, was bedeutet das? Etwas als so freiheitlich zu beschreiben, wie es über die freie Szene getan wird, bedeutet für mich erst einmal, dass in diesem Rahmen eine andauernde Diskursverschiebung stattfindet. Dabei geht es nicht darum, wie lange du wo bist, sondern was du innerhalb eines Raumes machst, was du denkst, wen du selbst hineinlässt. Denn das, was du im Kern dabei tun kannst ist, gelassen anzuerkennen, dass sich alles verändert und eine freie Szene ein Prozess ist. Was ist die freie Szene?, fragen sich in einem Video der IG Kultur Österreich im Jahr 2018 auch mehrere Kulturarbeiter*innen. In einem daran anschließenden Video geht es um die Frage der Freiheit in dieser Szene selbst, also: Wie frei ist die freie Szene wirklich? Ich stelle mir die erste wie die zweite Frage ständig und finde keine eindeutigen, keine homogenen Antworten: Es geht für mich darum nicht-kommerziell zu arbeiten, sich im besten Fall als Ehrenamtliche irgendwie entlohnen zu können und besonders im Vordergrund steht dabei Künstler*innen zu bezahlen, die man in die eigenen Orte einlädt. Außerdem geht es um kollektive, gar basisdemokratische Entscheidungsprozesse und einen Zusammenhalt gegen Angriffe auf die schon erkämpfte Freiheit. Zur zweiten Frage möchte ich hier sagen: Die Freiheit, frei zu sein hat Hannah Arendt vollumfänglich durchdekliniert.
In Deutschland gibt es, anders als in Österreich, noch keine IG (Interessengemeinschaft) Kultur. „Die zentrale Aufgabe der IG Kultur Österreich liegt in der Verbesserung der Arbeitsbedingungen für emanzipatorische Kulturarbeit. Sie fungiert als kulturpolitische Interessenvertretung und als Beratungsinstanz im Auftrag der Kulturinitiativen.“ (IG Kultur Österreich) Sollten wir das nicht angesichts der aktuellen Lage schnellstmöglich ändern? Aber was bedeutet das alles jetzt gerade für mich in Köln? Manchmal habe ich das Gefühl, es ergeben sich unendlich viele Möglichkeiten und am nächsten Tag scheint alles zum Scheitern verurteilt, gerade wenn uns auch noch Leistungen gekürzt werden, obwohl wir vorher auch schon kaum etwas zu verteilen hatten, um uns zum Beispiel faire Löhne zu bezahlen. Im Endeffekt weiß ich, dass auch 2025/2026 großartige Projekte umgesetzt werden. Doch vermutlich werden die Menschen, die sie ins Leben gerufen haben, weiter armutsgefährdet bleiben.
Die IG Kultur Österreich hat auch den Text „Vom Kreativproletariat zu kulturellen Arbeiter*innen“ veröffentlicht. Der Autor Günther Friesinger schreibt, „Es wird von ihnen erwartet, Erwartungshaltungen zu enttäuschen. Und anders zu sein als alle anderen“, wobei er mit „ihnen“ uns alle meint. „Ihnen“, das sind die Künstler*innen und im weitesten Sinn auch Kulturarbeiter*innen, denen durch unsere (liberal-)kapitalistische Gesellschaft „die Freiheit“ zwar gegeben wird, das Brot jedoch verwehrt bleibt. Es wird in diesem Text umso deutlicher, was für ein schwerwiegendes Problem die Vereinzelung der Produzent*innen ist, denn das, was uns Schutz bieten kann, ist das Kollektiv. Zum Glück gibt es auch Geschichten, die uns positiv inspirieren können: Zum Beispiel die Arbeiterinnenbewegung Anfang der 1900er Jahre, die zur Konstituierung des 8. März führte. Vielleicht liege ich in dieser Annahme falsch, doch irgendwie kommt es mir so vor, als ob der Jetztzustand genau einer solchen (neuen) Bewegung den Nährboden bieten würde. Von Menschen, die sich gerade schon organisieren wird mir berichtet, dass eine neue Motivation innerhalb und außerhalb ihrer Gruppen einen starken Zuwachs erzeugt. Ich sehe diesen Handlungsdrang auch in der freien Kulturszene, denn es hat sich ein gemeinsamer Konsens gebildet, der das Kürzen von Etats als eine fatale Entscheidung gegen reale Demokratieprozesse entlarvt. Langsam werden auch in der Mehrheitsgesellschaft die Fehler im System entdeckt und Verbindungen zwischen Gewaltverhältnissen wieder hergestellt. In diesem Sinne: Aktivist*innen und Kulturarbeiter*innen vereinigt euch!