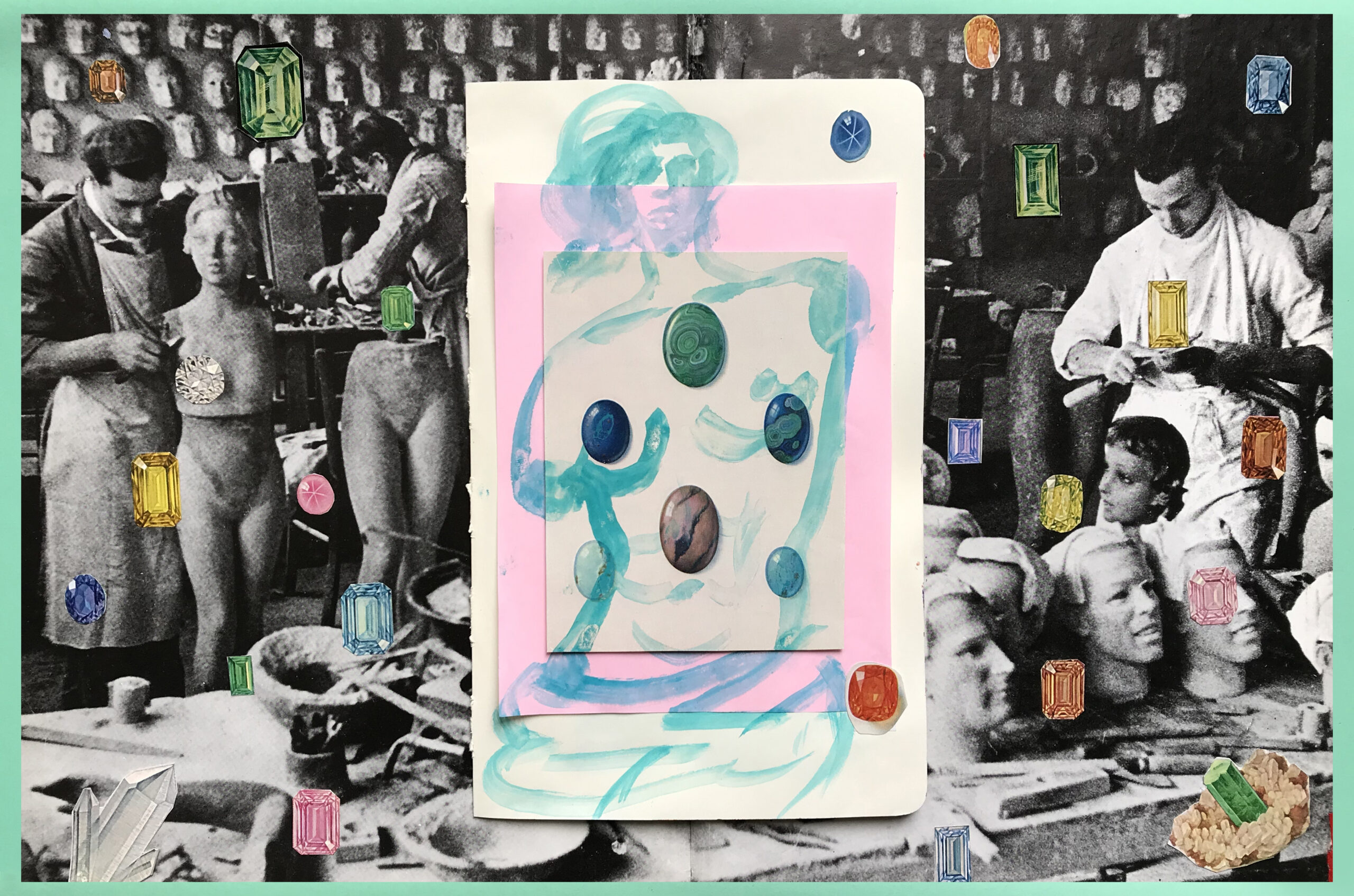Sie ist nah. Niemand schaut hin. Ich könnte den Arm ausstrecken und sie berühren. Ich tue es nicht. Die glatte Oberfläche der Steinskulptur hat außerhalb eines Museums keine Anziehungskraft. Der Kontext macht das Kunstwerk. Das Kunstwerk braucht Absperrbänder und Sicherheitsglas, Aufsichtspersonal und ein Schild: „Bitte nicht berühren.“ Das Kunstwerk braucht eine*n Urheber*in und Menschen, die es als Kunstwerk anerkennen.
„Forscher haben beispielsweise ein wertvolles Kunstwerk auf dem Gehweg platziert und festgestellt, dass niemand hinsieht.“ (Siri Hustvedt, Wenn Gefühle auf Worte treffen)
Das, was vor mir steht, ist Kitsch. Wie die Weintrauben aus Wachs, die von der Decke herabhängen, wie die künstlich zerbrochenen Terrakottatöpfe auf den Fensterbänken, wie die Wandmalereien, die einen Blick auf weiße Häuser und blaue Dächer vortäuschen. Ich bin mir sicher, die Skulptur schon einmal gesehen zu haben. Wie ärgerlich, denke ich, einen Moment lang beim Modellstehen nicht aufgepasst und die nächsten Tausende von Jahren zierst du Lokale und Imbisse, die irgendetwas Mediterranes servieren.
Die Geschichte gefällt mir.
Ich steigere mich in diese rein und bin enttäuscht, als ich später erfahre, dass es sich bei der Skulptur vermutlich um eine Nachbildung der Venus von Milo handelt. Enttäuscht, weil die Forschung eine unbefriedigende Antwort auf die Frage hat, wer für die Venus Modell gestanden haben könnte: niemand!
Die Geschichte gefällt mir zu sehr. Ich werde mir weiterhin vorstellen, wie vor über 2000 Jahren in einem stickigen staubigen Atelier ein Modell, ein echter Mensch mit einem eigenen Leben, eigenen Gedanken und Wünschen für einen Bildhauer posierte, und dass daraus die Venus von Milo mit ihren Millionen von Plastiknachbildungen entstanden ist.
Warum denn nicht?
Schließlich kannte ich auch die britische Malerin und Dichterin Elizabeth Eleanor Siddal bis vor Kurzem lediglich als das tote Mädchen im Fluss aus dem Gemälde Ophelia von John Everett Millais. Dass sie ein eigenes Leben, eigene Bestrebungen hatte, war mir nicht in den Sinn gekommen. Siddal war Dichterin und Malerin, doch diese Seite ihres Lebens bleibt bis heute nur wenig ausgeleuchtet. Selbst aktuelle Beiträge mit Titeln wie Die wahre Ophelia scheitern daran, ihr eine Persönlichkeit zu geben. Die Künstlerin bleibt Muse und Ehefrau, zu tragisch, zu fragil für das echte Leben. „Dabei war sie in Wirklichkeit eine sehr resolute Person, weit entfernt von der ausdruckslosen, passiven Opfergestalt, als die sie von ihren männlichen Zeitgenossen inszeniert wurde.“ (Katy Hessel, The Story of Art without Men. Große Künstlerinnen und ihre Werke)
Das Nichtbenennen hat System und ungeheuerliche Ausmaße. Wer einmal beginnt, darauf zu achten, wird erstaunt sein. Es ist eine Konstante, die Basis unseres kulturellen Erbes.
Aber die Muse hatte schon immer einen Namen.